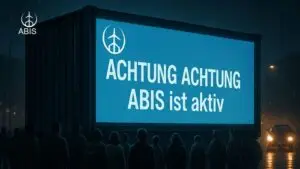Wie Unternehmen ihre Zukunft mit Mitarbeitenden gestalten
Vorgestellt am Landesverbandstag 2025 in Kiel
Von den Performance Experten des BDS SH: Jürgen Wirobski, Ina Rathje und Erol Ergün

Das Missverständnis über INQA
Viele Unternehmer:innen denken bei INQA-Coaching zunächst an klassische Unternehmensberatung: Ein externer Coach kommt ins Unternehmen, analysiert die Probleme und präsentiert die Lösung. Die Verantwortung liegt beim Berater.
Das ist ein häufiger Irrtum.
INQA-Coaching funktioniert anders – und genau das macht es so wertvoll: Es ist kein Standard-Programm „von oben herab“, sondern ein partizipativer Prozess, in dem das ganze Team mitgenommen wird.
Das Ziel ist nicht, dass am Ende ein dicker Bericht auf dem Schreibtisch liegt. Das Ziel ist, dass die Mitarbeitenden befähigt, überzeugt und gestärkt werden – sodass sie die Lösung selbst tragen, weiterentwickeln und zukunftssicher umsetzen können.
Die echte Vielfältigkeit von INQA
INQA ist keine Schublade. Das wird oft missverstanden. Genauso wenig wie jedes Unternehmen die gleichen Herausforderungen hat, gibt es auch nicht die eine „INQA-Lösung“.
In der Praxis zeigt sich: INQA hilft bei einer überraschend breiten Palette von Herausforderungen.
Einige Beispiele aus der Realität:
1. Digitalisierung, die Menschen mitnimmt
Ein häufiges Szenario: Ein Unternehmen bemerkt, dass viel Zeit mit manuellen Prozessen verloren geht. Excel-Tabellen werden hin- und hergeschoben, niemand weiß mehr genau, welche Version aktuell ist, und jede Änderung der Formel erfordert einen Anruf beim Kollegen, der diese vor Jahren mal programmiert hat.
Die naheliegende Lösung ist neue Software. Power BI, ERP-Systeme, digitale Lösungen – es gibt viele Optionen.
Aber hier kommt der INQA-Gedanke ins Spiel: Bevor man eine technische Lösung implementiert, muss man die Menschen mitnehmen. Das heißt konkret:
- Junge Mitarbeitende (die mit der Technologie vertraut sind) und erfahrene Kollegen arbeiten gemeinsam an der Lösung
- Alle verstehen, warum die Änderung sinnvoll ist – nicht nur die Geschäftsleitung
- Das Team bestimmt mit, welche Daten sichtbar gemacht werden und wie (Vertrieb braucht andere Übersichten als Einkauf)
- Die Begeisterung derjenigen, die den Nutzen direkt spüren, wächst – und verbreitet sich weiter
Das Ergebnis: Die Lösung wird nicht nur implementiert, sondern gelebt. Und die Akzeptanz ist viel höher, wenn Menschen verstehen, dass ihre Arbeit leichter wird.
Das ist agile Methodik in der Praxis: Kontinuierliches Feedback, schnelle Iterationen, Mitnahme statt Diktatur.
2. Prozessstandardisierung in heterogenen Teams
Ein anderes Beispiel: Ein inhabergeführtes Gastro-Unternehmen mit etwa 80 Mitarbeitenden – viele davon Schichtarbeitende, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Erfahrungsniveaus.
Für den Geschäftsbetrieb sind klare Prozesse essentiell:
- Was passiert, wenn es einen Notfall gibt?
- Wie läuft die Onboarding-Schulung?
- Welche IT-Richtlinien gelten?
- Wie gehen wir mit sensiblen Daten um?
Das Problem: Diese Prozesse existieren teilweise nur im Kopf. „Das machen wir halt so, seit 20 Jahren funktioniert es.“ Aber funktioniert es wirklich noch? Und vor allem: Sind alle Mitarbeitenden damit vertraut?
Hier greift INQA an:
- Strukturanalyse: Wie geht es bei euch wirklich? (Nicht wie es auf dem Papier steht)
- Abgleich mit gesetzlichen Anforderungen
- Gemeinsame Entwicklung von verständlichen Richtlinien und Kommunikationskanälen
- Wichtig: Es werden nicht nur schriftliche Dokumente erstellt. Das Team entwickelt auch Videos, Podcasts, visuelle Anleitungen – in verschiedenen Sprachen und Formaten, damit es jeder versteht
Das ist nicht nur Prozessoptimierung, das ist Sicherheit und Qualität für alle.
3. Fachkräfte gewinnen und halten
Ein klassisches Thema: Personalfluktuation. Gute Leute kündigen, neue Kandidaten zu finden ist schwer.
INQA hilft hier, die tieferen Fragen zu stellen:
- Was fehlt? Ist es wirklich nur das Gehalt oder auch Entwicklungschancen, Arbeitskultur, Flexibilität?
- Wie präsentieren wir uns als Arbeitgeber nach außen?
- Welche informellen Prozesse könnten wir formalisieren, damit neue Mitarbeitende schneller ankommen?
Und wieder: Das Team hilft bei der Analyse und Lösung. Denn die Mitarbeitenden wissen oft besser als die Chefin, welche Hürden es gibt.
Das zentrale Element: Mitarbeitende als Gestaltende
Was alle diese Szenarien verbindet, ist ein Kernelement von INQA:
Mitarbeitende werden nicht Objekte einer Veränderung, sondern Subjekte. Sie sind Experten ihrer eigenen Arbeit.
Das bedeutet praktisch:
- Strukturierte Befragung und Analyse: Wir holen nicht nur die Chefin ins Boot, sondern auch die Praktiker:innen.
- Gemeinsame Lösungsfindung: Nicht der Coach sagt, was zu tun ist, sondern das Team arbeitet zusammen.
- Befähigung statt Dienstleistung: Unser Ziel ist es, dass die Mitarbeitenden nach dem Coaching die Prozesse selbst weiterentwickeln und anpassen können – ohne externe Hilfe.
Das erfordert eine andere Haltung vom Berater: Moderieren statt Anweisen. Ermutigen statt Expertentum zur Schau stellen.
Und es funktioniert. Die Erfahrung zeigt, dass diese partizipativen Prozesse nicht nur zu besseren Lösungen führen (weil die praktische Erfahrung eingebunden ist), sondern auch zu größerer Zufriedenheit und Bindung der Mitarbeitenden.
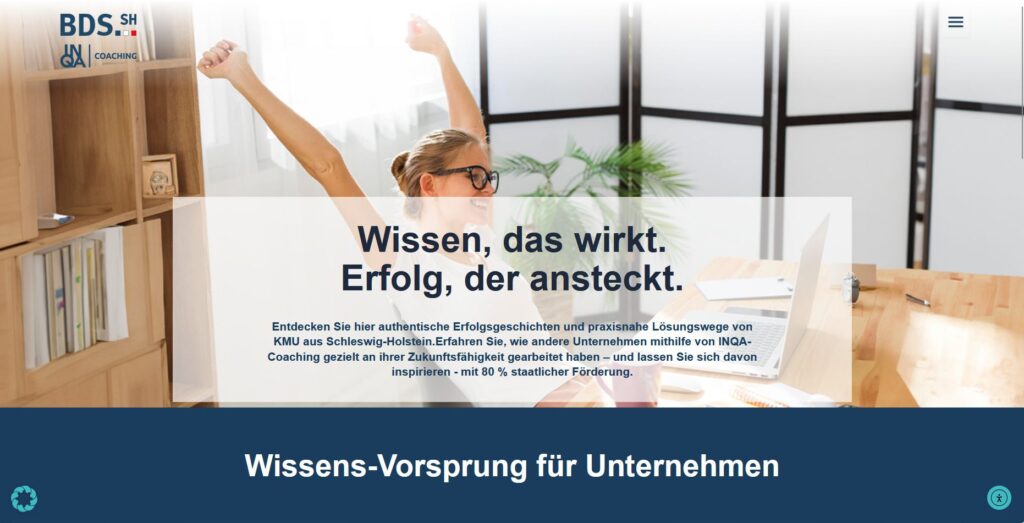
Agile Methoden statt Wasserfall-Denken
Ein weiterer roter Faden durch diese Projekte: Agiles Denken.
Traditionelle Beratung funktioniert oft nach Wasserfall-Logik:
- Phase 1: Analyse abgeschlossen
- Phase 2: Lösung entworfen
- Phase 3: Umgesetzt
- Fertig.
INQA funktioniert anders:
- Schnelle Zyklen: Nicht am Ende ein perfektes Konzept, sondern regelmäßige Zwischen-Schleifen: „Wo kommen wir her? Was funktioniert? Was brauchen wir noch?“
- Kontinuierliche Anpassung: Das Team testet die Lösung, sammelt Feedback, passt an.
- Kleine Gruppen, schnelle Iterationen: Neue Ideen werden in kleinen Gruppen durchdacht, nicht in großen Workshops ertötet.
Diese agile Herangehensweise ist besonders wertvoll, wenn es um Prozesse und Tools geht. Denn die erste Idee ist oft nicht die beste – aber das Team findet sie zusammen schneller heraus, wenn es in regelmäßigen Schleifen reflektiert.
Der praktische Nutzen: Sichtbarmachen, Automatisieren, Verstehen
Was kommt am Ende eines solchen INQA-Prozesses heraus? Das ist sehr unterschiedlich – und genau das ist das Schöne daran.
Manchmal sind es:
- Dashboard und Automatisierung: Daten, die vorher manuell gepflegt wurden, sind jetzt automatisiert und allen verfügbar.
- Standardisierte Prozesse: Was vorher ungeschrieben war, ist jetzt dokumentiert – in schriftlicher Form, als Video, als Checkliste.
- Klare Rollen und Verantwortungen: Wer macht was? Wer entscheidet? Wer wird informiert?
- Kultur der Sicherheit: Mitarbeitende verstehen, warum bestimmte Richtlinien wichtig sind – nicht nur, dass sie existieren.
Das Gemeinsame: Die Lösung ist praxisnah, nachvollziehbar und wartbar – nicht theoretisch, nicht überkompliziert.
Warum das 80%-Förderung-Argument zu kurz greift
Ja, INQA wird zu 80% gefördert. Das ist natürlich attraktiv. Aber das ist nur die oberflächliche Geschichte.
Die tiefere Geschichte ist: Zukunftsgestaltung wird vom Luxus zur Normalität.
Viele Unternehmer:innen wissen intuitiv, dass sie etwas ändern müssen. Die Märkte verändern sich, Fachkräfte sind rar, Digitalisierung wartet nicht. Aber die Investition in externe Beratung scheint unerschwinglich – und der Aufwand für interne Veränderung ist groß.
INQA senkt diese Hürde nicht nur finanziell, sondern auch mental: Es ist ein strukturiertes, von außen moderiertes Programm, das Gewissheit gibt, dass die investierte Zeit tatsächlich zu Ergebnissen führt.
Und vor allem: Es funktioniert mit den Mitarbeitenden, nicht gegen sie.
Agile als Daueraufgabe, nicht als Projekt
Am Ende noch ein wichtiger Gedanke:
INQA ist kein Projekt, das mit dem Coach endet. Es ist eher ein Impuls.
Die beste INQA-Beratung pflanzt ein Verständnis dafür, dass agiles Denken – kontinuierliche Verbesserung, Mitnahme der Mitarbeitenden, schnelle Iterationen – der Weg ist, die Zukunft zu gestalten.
Das bedeutet: Nach dem Coaching liegt die Verantwortung wieder bei den Mitarbeitenden und der Geschäftsleitung. Sie haben die Werkzeuge, die Prozesse, die Haltung. Sie müssen die Kultur der kontinuierlichen Verbesserung selbst weitertragen.
Das klingt anspruchsvoll – und das ist es auch. Aber genau das ist der Unterschied zwischen einer kurzfristigen Problemlösung und einer echten Transformation.

Fazit: INQA ist das Gegenteil von Beratungs-Standard
INQA-Coaching fällt aus dem Rahmen klassischer Beratung. Es ist:
- Partizipativ: Das Team ist nie Zuschauer, immer Gestaltender
- Agil: Keine großen Masterplans, sondern schnelle Zyklen und Anpassung
- Praktisch: Die Lösungen müssen im echten Betrieb funktionieren
- Vielfältig: Von Digitalisierung über Prozesse bis zu Kultur – es richtet sich nach deinem Bedarf
- Befähigend: Ziel ist, dass dein Team nach dem Coaching eigenständig weitergehen kann
Wenn du merkst, dass dein Unternehmen Veränderung braucht, aber die Hürde mit externen Berater:innen zu hoch ist – das ist genau der Punkt, wo INQA ansetzt.
Nicht als Luxus. Sondern als strukturierter Weg, gemeinsam mit deinen Mitarbeitenden die Zukunft zu gestalten.
Nächste Schritte
Du erkennst dich wieder? Dein Unternehmen könnte von einem INQA-Coaching profitieren?
Dann kontaktiere den BDS SH. Wir prüfen kostenlos, ob dein Unternehmen förderfähig ist und welches Thema gerade am meisten Sinn macht.
Dein Vorteil: Bis zu 80% Förderung. Und echte Unterstützung von Coaches, die selbst aus der Praxis kommen.
Fragen zum INQA-Programm, zur Förderung oder zum BDS SH? Schreib uns gerne oder vereinbare ein unverbindliches Gespräch.
Der Vortag:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen